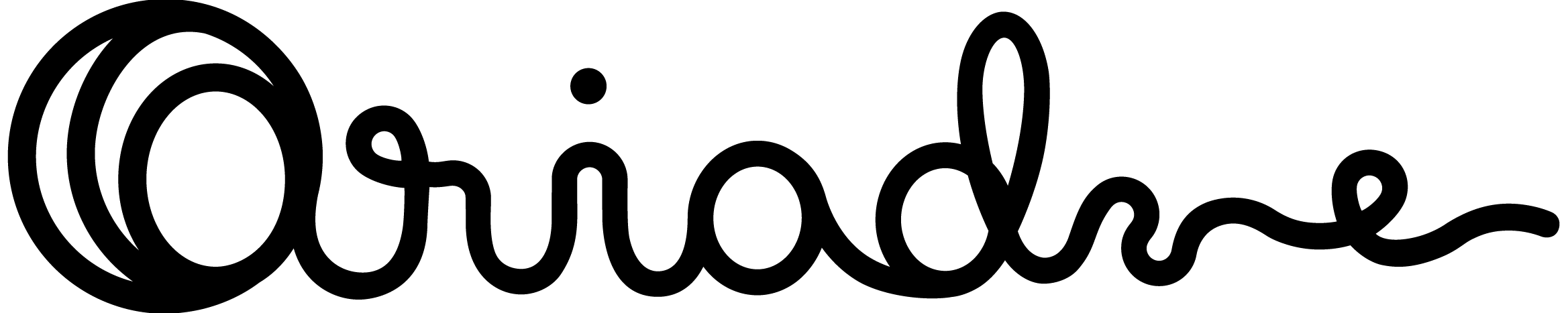Die Hilfsbereitschaft Europas gegenüber Vertriebenen aus der Ukraine ist groß. Der in vielen Ländern stark verwurzelte strukturelle Rassismus sorgt dafür, dass schnell in „gute“ und „schlechte“ Flüchtlinge getrennt wird.
Im Jänner 1993 stand ich mit meiner Familie vor den Toren des Flüchtlingslagers in Traiskirchen, endlich an einem Ort, wo wir vor dem Krieg in meiner Heimat, Bosnien und Herzegowina, sicher sein konnten. Vertrieben wurden wir, weil mein Vater einen muslimischen Namen trug und im dominanten serbischen Narrativ damit das „Andere“ konstituierte, das durch die Politik der „ethnischen Säuberung“ aus der Welt geschaffen werden sollte. Und nun waren wir Flüchtlinge in Österreich: mein aus einer muslimischen Familie stammender Vater, meine aus einer ukrainischen Familie stammende Mutter, beide Sozialisten und Atheisten; mein Bruder und ich als Kinder aus einer „Mischehe“. Der Name des Vaters besiegelte unser Schicksal in Bosnien und machte uns zu Feinden.
In Traiskirchen angekommen glaubten wir, dass wir ein für alle Mal diese Stigmatisierung hinter uns gelassen hätten. Traiskirchen war für uns ein Zwischenziel, wir wollten weiter nach Kanada. Der schnellste und leichteste Weg war über die ukrainische Community in Wien. Im ukrainischen Community-Center in der Postgasse, wo sich auch heute eine zentrale Anlaufstelle für die Hilfe für die ukrainischen Flüchtlinge befindet, teilte uns der ukrainische Pfarrer, mit dem wir dort das offizielle „Bewerbungsgespräch“ für die Emigration nach Kanada führten, trocken mit, dass für meine Mutter und uns Kinder der Weg nach Kanada frei sei. Für meinen Vater, so der Pfarrer, würde dies leider nicht gehen, die Muslime nehme man nicht auf. So wurde mein Vater zu einem „schlechten“ Flüchtling, zu einem Flüchtling, den man aufgrund der Religion seiner Eltern, mit der er ideologisch nichts zu tun hatte, zum nicht wünschenswerten „Anderen“ degradierte. Der rassistische ukrainische Pfarrer bestimmte das Schicksal meiner Familie.
Pragmatisch und unbürokratisch
Nun im schnellen Vorwärtsgang in die Gegenwart. Bei Flüchtlingen aus der Ukraine sind wir derzeit Zeugen einer enormen Hilfsbereitschaft und der Solidarität mit Geflüchteten. Die EU hat mit der sogenannten Massenzustromrichtlinie schnell reagiert, die Hilfsbereitschaft allerorten ist groß. Die Zivilgesellschaft als zentrale gesellschaftliche Solidaritäts- und Hilfssäule ist wie schon 2015 enorm stark. Auch die staatlichen Institutionen in Österreich helfen weitgehend pragmatisch und unbürokratisch.
Schaut man etwas genauer hin, sind die zentralen Dilemmata der europäischen Flüchtlings- und Asylpolitik weiterhin sichtbar. Die meisten Flüchtlinge sind weiterhin in den Nachbarstaaten der Ukraine, die starke Unterstützung brauchen. Eine bessere Verteilung der ukrainischen Flüchtlinge ist innerhalb der EU (noch immer) kein Thema. Alte Grundfesten der europäischen Flüchtlingspolitik scheinen vom Ukraine-Krieg unberührt zu sein. Europa öffnet sich für Flüchtlinge aus der Ukraine, bleibt aber für die anderen ein Europa der Zäune, der Begrenzung und des Einriegelns.
„Europa öffnet sich für Flüchtlinge aus der Ukraine, bleibt aber für die anderen ein Europa der Zäune, der Begrenzung und des Einriegelns.“
Das Bild eines umzäunten Europas, das sich ab 2015 verfestigt hat, ist weiterhin da. Inmitten der Welle der Solidarität mit ukrainischen Flüchtlingen darf man nicht vergessen, dass all die errichteten Zäune und Abschottungsmechanismen weiterhin da sind. Wir dürfen nicht vergessen, dass es an europäischen Außengrenzen gewalttätige Pushbacks gibt, die von einigen Staaten wie Kroatien systematisch und staatlich organisiert sind. Letztlich dürfen wir auch nicht vergessen, dass gerade in Polen, das sich nun so stark für die ukrainischen Flüchtlinge einsetzt, im Norden an der Grenze zu Belarus der Stahlzaun die Flüchtlinge aus Syrien oder Afghanistan stoppt.